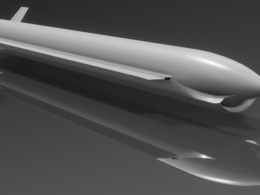Das Future Combat Air System (FCAS) erreicht eine entscheidende Phase. Acht Jahre nach seinem Start zeigt das Programm deutliche Risse entlang nationaler Interessen. Während Frankreich um die Mehrheitskontrolle über den Next Generation Fighter (NGF) ringt, verfolgt Deutschland einen anderen Ansatz: Es definiert FCAS zunehmend als Rahmen für Interoperabilität und schafft parallel eine eigene Basis – den Combat Fighter System Nucleus (CFSN).
Offizielle in Berlin bezeichnen CFSN inzwischen nicht mehr als bloßes Nebenprojekt, sondern als strukturellen Nachfolger von FCAS. Das Ziel: Europas erste einsatzfähige Combat Cloud sowie eine Familie kollaborativer unbemannter Luftfahrzeuge bereitzustellen.
Die Auseinandersetzung
Auf dem Air Force Tech Summit in Berlin lieferte Oberst Jörg Rauber, deutscher FCAS-Programmmanager beim BMVg, eine ungewöhnlich offene Einschätzung. Wie zunächst von Defence-Network berichtet, präsentierte er eine Grafik der geplanten FCAS-Struktur: ein ausgewogenes Gefüge multinationaler Komponenten – eine „globale Balance“, wie er es nannte. „Diese globale Balance wird nun infrage gestellt“, erklärte Rauber. Mehrere Partner wollten demnach Flugzeuge und unbemannte Systeme zunehmend als nationale Assets behandeln. Das vehindere die Balance vollständig. Dies sei die zentrale Herausforderung beim Übergang zu Phase 2.
Rauber bestätigte, dass Dassault und der neue französische Verteidigungsminister kürzlich erneut Mehrheitskontrolle über spezifische Designbereiche beansprucht hatten – entgegen früherer Workshare-Vereinbarungen. Deutschland wolle „im etablierten Setup fortfahren“, erklärte er. „Aber wenn das nicht mehr funktioniert, müssen wir Alternativen in Betracht ziehen.“ Seine Schlussfolgerung fiel pragmatisch aus: „Ja, das Programm muss weitergehen. Die Frage ist nur: Wie?“ Eine politische Entscheidung wird noch vor Jahresende erwartet.
Was von FCAS übrig bleibt
Jenseits der Rhetorik hat sich das gemeinsame Programm auf sein technisches Rückgrat reduziert: die Combat Cloud und ihre zugrundeliegende Datenarchitektur. BAAINBw-Offizielle definieren das FCAS inzwischen primär als „Koordinierungsrahmen für Interoperabilität zwischen nationalen Systemen“. Demonstratoren für Sensoren und Datenlinks bleiben aktiv, doch das Konzept eines einzigen, gemeinsam entwickelten NGF ist weitgehend vom Tisch. Die in Berlin diskutierte Roadmap der deutschen Luftwaffe skizziert vier zentrale Ziele für die Ära nach dem vollumfänglichen FCAS:
- CFSN Combat Cloud: Die nationale Kommando- und Datenebene bildet das deutsche Rückgrat der erweiterten FCAS Combat Cloud und gewährleistet Interoperabilität über alliierte Netzwerke hinweg.
- CCA-Entwicklung: Zwei Klassen unbemannter Systeme (4–5 t und 10 t) für Begleit-, Angriffs- und Störrollen.
- Integration existierender Plattformen: Eurofighter EK, F-35A und zukünftige Drohnen werden über Datenfusion vernetzt.
- Next Generation Fighter: Entwicklung eines Eurofighter-Nachfolgers, idealerweise in Kooperation mit Spanien und/oder Schweden.
Parallel dazu hat Berlin technische Gespräche mit GCAP-Mitgliedern im Vereinigten Königreich und Italien aufgenommen, um die Ausrichtung von Datenlink und Interoperabilität zwischen CFSN und der anglo-italienisch-japanischen Systemarchitektur auszuloten. Ziel ist die Ausweitung der Combat-Cloud-Kompatibilität über europäische Projekte hinweg.
Deutschlands Alternative: CFSN
Zeitgleich unterstrich Martin Heltzel aus dem BAAINBw die neue Ausrichtung des Programms. Deutschland beabsichtige, „die erste Nation in Europa zu werden, die eine unbemannte Kampfplattform operationalisiert“, erklärte er – im Rahmen von CFSN.
Diese Systeme, faktisch deutsche Collaborative Combat Aircraft (CCA), werden als erstes greifbares Ergebnis von CFSN dienen. Die 4–5-Tonnen-Klasse konzentriert sich auf Aufklärung und elektronische Kriegsführung, die 10-Tonnen-Variante auf Luft-Boden- und Luft-Luft-Einsätze. Der von der Luftwaffe skizzierte Gesamtbedarf für größere CCAs liegt derzeit bei rund 400 Systemen. Beschaffung und erste Erprobungslieferungen sollen voraussichtlich 2029 beginnen. Deutschland drängt auf nationale Entwicklungsführerschaft: Mindestens eine Fertigungslinie und eine Missionssystem-Suite sollen im hierzulande gebaut und entworfen werden.

Im Rahmen von CFSN fungiert die Combat Cloud als digitales Rückgrat, das bemannte und unbemannte Plattformen durch verschlüsselten Datenaustausch verbindet – vollständig kompatibel mit NATOs Federated Mission Networking und den etablierten Link 16/22/MADL-Standards. Ein hochrangiger Beschaffungsbeauftragter brachte das Konzept auf den Punkt: „Interoperabilität ist nicht länger Nebeneffekt, sondern primäres Ziel.“
Potenzielle Optionen
Sollte die trilaterale FCAS-Vereinbarung mit Frankreich und Spanien scheitern, hält sich Deutschland Alternativen offen. Schweden hat sich als bevorzugter Ersatzpartner herauskristallisiert. Saab-CEO Micael Johansson erklärte kürzlich in einem Interview mit Table.Briefings, sein Unternehmen sei „bereit, eine gemeinsame künftige Luftkampfarchitektur mit Deutschland zu erkunden, einschließlich unbemannter Systeme und Kampfflugzeugtechnologien der nächsten Generation.“
Obwohl keine formelle Vereinbarung angekündigt wurde, haben sich die Kontakte auf Arbeitsebene zwischen deutscher und schwedischer Industrie intensiviert. Saabs Erfahrung in Systemintegration und elektronischer Kampfführung deckt sich eng mit Deutschlands CFSN-Ansatz. Bestehende Kooperationen wie etwa beim Eurofighter EK könnten als technologische Brücke für künftige gemeinsame Vorhaben dienen.
Französischer Alleingang
Paris hingegen konsolidiert sein nationales NGF-Konzept auf Basis des Rafale-F5-Standards. Dassault Aviation entwickelt die F5 zu einer neuen Plattform mit Systemen weiter, die auf einem verbesserten RBE2-XG-Radar, einem neuen Triebwerksdesign im Rahmen des T-REX-Programms und einer Schnittstelle für die Kooperation mit unbemannten Systemen basieren. Französische Regierungsvertreter bezeichnen dies als kosteneffiziente Weiterentwicklung, die industrielle Souveränität wahrt.
Der Schritt schließt ausländische Partner faktisch von der künftigen französischen Luftkampfentwicklung aus und verstärkt Frankreichs Bindung an seine exporterprobte Industriebasis. Während dies Dassaults Marktposition und nationale Kontrolle stützt, begrenzt es auch technologischen Input und Programmumfang – bedingt durch verringerte externe Zusammenarbeit und budgetäre Beschränkungen.
Schlussfolgerung
Das Future Combat Air System fungiert mittlerweile eher als politisches Dach denn als einheitliches Programm. Sein praktisches Vermächtnis dürfte geteilt ausfallen: Frankreich wird einen souveränen Rafale-Nachfolger kleineren Umfangs sowie einen möglichen Nachfolger des nEUROn-UCAV vorantreiben, während Deutschland das CFSN mit eigenen Collaborative Combat Aircraft aufbaut und ein deutsch-spanisch-schwedisches Kampfflugzeugkonzept auslotet.
In diesem Rahmen zielt CFSN darauf ab sicherzustellen, dass Europas nächste Generation von Luftstreitkräften nicht in einer Fabrik oder unter einer Flagge entsteht, sondern über verbundene, interoperable Netzwerke.
Dieser Artikel erschien erstmals am 12. November 2025 in englischer Sprache auf der Website »Defense Archives«.
Mit WhatsApp immer bestens informiert!
Abonniere unseren WhatsApp-Kanal, um Neuigkeiten direkt aufs Handy zu erhalten. Einfach unten auf den Button klicken und dem Kanal beitreten: